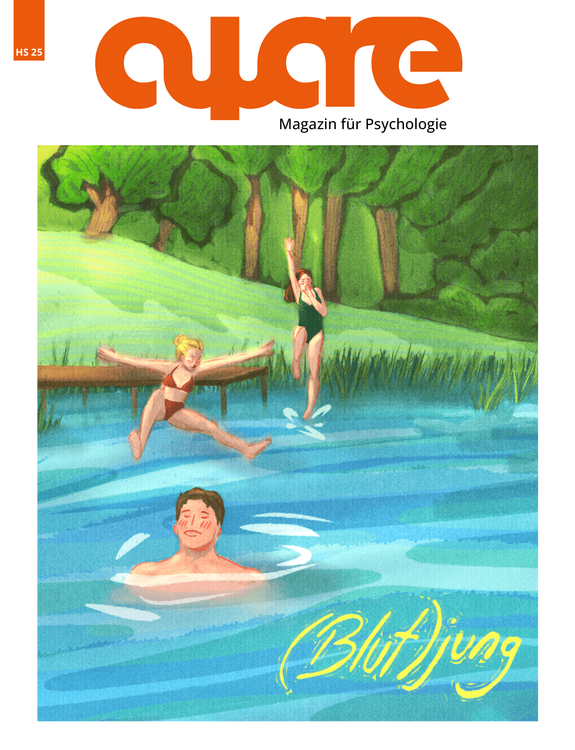Ein hoher IQ: Für die einen wünschenswert, für die anderen bedeutungslos. Wie die Psychologie denjenigen antwortet, die den IQ nur für ein Hirngespinst halten, ist im folgenden Artikel zu finden.
D ie Intelligenz bildet in der noch kurzen Geschichte der Psychologie eines ihrer ältesten und am besten untersuchten Forschungsobjekte. Was dieses Thema so interessant macht, ist seine Allgegenwärtigkeit; schnell lernten wir, dass die Unterschiede zwischen Lisa und Nora in ihrer Fähigkeit, sich die englische Sprache anzueignen oder die mendelschen Regeln der Genetik nachzuvollziehen, zumindest teilweise auf eine unterschiedliche Ausprägung einer dahinterliegenden Eigenschaft – der Intelligenz – zurückzuführen sind.
In dieser Hinsicht scheint Einigkeit zu herrschen. Allerdings werden Psycholog*innen immer wieder mit Zweifeln daran konfrontiert, ob diese sogenannten IQ-Tests tatsächlich das messen, was allgemein als Intelligenz bezeichnet wird. Was diese Diskussion weiter anheizt, ist wohl der Fakt, dass sie nicht unberührt vom Selbstwert ihrer Diskussionsteilnehmer*innen bleibt. Des Weiteren scheiden sich die Geister darüber, ob diese seltsame Eigenschaft in der Tat von solcher Relevanz ist, wie Psycholog*innen behaupten. Auch scheint Uneinigkeit darüber zu herrschen, was der Begriff Intelligenz eigentlich umfasst und wann jemand genug davon zu haben scheint. Im folgenden Artikel wird auf diese landläufigen Fragen eingegangen, in der Hoffnung, dieses faszinierende, aber auch komplexe Thema etwas zu entwirren.

«Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst»
So lautet das berühmte Zitat des Psychologen Edward Boring, wie es die Einleitung zahlreicher Artikel über die Intelligenz prägt. Dieser Zirkelschluss drängt Intelligenzforschende weit über Borings Tod hinaus in Erklärungsnot. Aber wie kommt es, dass ausgerechnet ein Psychologe, ein Anhänger derjenigen Disziplin, die gerade die Deutungshoheit über diesen Begriff hegt, eine solche Kritik äussert? Stimmt also die Redewendung, es gäbe so viele Intelligenzdefinitionen wie Intelligenzforscher*innen? Wie später noch ersichtlich wird, gibt es viele verschiedene Konzeptionen der Intelligenz, welche auch in der neueren Forschung durch weitere Konzepte wie die emotionale oder soziale Intelligenz ausgeweitet werden. In der Tat fasst dieses Zitat die Zweifel der Skeptiker*innen gut zusammen. Wie aus Elsbeth Sterns und Aljoscha Neubauers intelligenztheoretischem Manifest Intelligenz: kein Mythos, sondern Realität (2016) hervorgeht, wird Borings Zitat allerdings häufig aus seinem Kontext gerissen, um auf schelmische Weise die Intelligenzforschung zu diskreditieren. Vielmehr wollte Boring die Forschungslage der 1920er Jahre beschreiben, als die Intelligenzforschung kritisieren: «Intelligence is what the tests test. This is a narrow definition, but it is the only point of departure for a rigorous discussion of the tests. It would be better if the psychologists could have used some other and more technical term, since the ordinary connotation of intelligence is much broader. The damage is done, however, and no harm need result if we but remember that measurable intelligence is simply what the tests of intelligence test, until further scientific observation allows us to extend the definition» (Boring, 1923, zitiert nach Stern & Neubauer, 2014). Damals verfügte das Feld der Intelligenzforschung nämlich bereits über aussagekräftige Tests zu der kognitiven Leistungsfähigkeit von Personen. Boring betont dadurch lediglich die Diskrepanz zwischen der quantifizierbaren, psychologischen Intelligenz und der breiteren Definition von Intelligenz im Volksmund. Erstere bedarf weiterer theoretischer Fundierung, um im nächsten Schritt diese sparsame und zirkuläre Definition abzulösen. Dieser Punkt scheint erreicht zu sein. Die Psychologin Linda S. Gottfredson lieferte uns eine viel zitierte Definition, für die sich führende Intelligenzforscher*innen (Nisbett et al., 2012) aussprachen: «Intelligence is a very general mental capability that, among other things, involves the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn from experience. It is not merely book learning, a narrow academic skill, or test-taking smarts. Rather, it reflects a broader and deeper capability for comprehending our surroundings- ‘catching on’, ‘making sense’ of things, or ‘figuring out’ what to do» (Gottfredson, 1984). Da die Psychologie eine Definition der Intelligenz besitzt, ist der Vorwurf, dass Psycholog*innen selbst nicht wissen, wovon sie reden, nicht länger haltbar (Stern & Neubauer, 2016).
G-factor und Co.: Kein Hirngespinst, sondern empirische Arbeit!
Hans Magnus Eszensberger wühlt in seinem reisserischen Werk Im Irrgarten der Intelligenz. Ein Idiotenführer von 2007 auf eine ironische, aber ernst zu nehmende Weise in den Wunden der Intelligenzforschenden. Darin macht er sich über die verschiedenen postulierten Arten der Intelligenz lustig: «Sie [die Forschenden] unterscheiden penibel, wie es ihre Art ist, zwischen biologischer und psychometrischer, motorischer und rationaler, analytischer und kreativer, sprachlicher und visueller, räumlicher und logisch-mathematischer, kinästhetischer und musikalischer, pragmatischer und mechanischer, interpersonaler und intrapersonaler, kristalliner und flüssiger, funktionaler und manipulativer Intelligenz – und das sind keineswegs alle Sorten, die es unter einer Haube zu bringen gilt». Damit suggeriert Enzensberger, dass die Betrachtungsweise der Intelligenz menschlicher Willkür unterliegt. Weiter führt Enzensberger die Kritik Goulds an, welcher in der Faktorenanalyse ein Mittel sieht, welches die Illusion einer Verdinglichung der nicht greifbaren Intelligenz schafft (Gould, 1983). Dabei leugnet Enzensberger nicht die Existenz der Intelligenz, sondern er verweist vielmehr darauf, dass die Menschheit zu wenig intelligent sei, um Intelligenz zu verstehen. So spottet er über den einflussreichen Persönlichkeitspsychologen Eysenck, dass sein Intelligenztest (mit dem Laien ihren IQ selbst ermitteln können) Aufgaben enthält, welche denjenigen aus den Rätselecken der Wochenzeitung gleichen.
Exploratorische Faktorenanalyse
Die Faktorenanalyse ist ein Analyseverfahren, welches in der Intelligenzforschung erstmals unter Spearman zum Einsatz kam. Ihr Zweck ist es, anhand der Messung manifester Variablen auf dahinterliegende, latente Variablen bzw. Faktoren zu schliessen. Es wird angenommen, dass Korrelationen zwischen den manifesten Variablen durch den Faktor verursacht werden. In Spearmans Fall bilden die Tests die manifesten Variablen, welche durch den dahinterliegenden g-factor positiv miteinander korrelieren.
Auch wenn es Enzensberger gegönnt sei, dass er sich in seinem kurzen, aber eindrucksvollen Werk als Laie auf kreative Weise mit dem Thema Intelligenz auseinandersetzt und dabei viele Skeptiker*innen aus der Seele sprechen mag, darf sein Spott nicht unkommentiert bleiben. Nachdem das Problem der Begriffsdefinition weitgehend aus dem Weg geräumt worden ist, soll nun anhand der Geschichte der Intelligenzforschung aufgezeigt werden, dass die Psychologie eine theoretisch fundierte Vorstellung der Intelligenz besitzt, die in der Forschungslandschaft auf weitläufigen Konsens stösst. In der Tat kursieren immer wieder neue Konzepte der Intelligenz. So zum Beispiel die nach Eysenck postulierte Unterscheidung in biologische, psychologische und soziale Intelligenz, die musikalische Intelligenz in Gardners Intelligenztheorie oder auch die praktische Intelligenz in Sternbergs triarchischem Intelligenzmodell (Funke & Vaterrodt-Plünnecke, 1998). Solche Anstösse regen den wissenschaftlichen Diskurs an, und während hier nicht an der Plausibilität dieser Modelle gezweifelt wird, werden im Rahmen dieses Artikels die Theorien behandelt, welche das Feld besonders geprägt haben. Nämlich weist die Psychometrie eine lange Tradition faktorenanalytischer Modelle der Intelligenz auf, die mit der Cattell-Horn-Carroll-Theorie eine zwar komplexe, allerdings aussagekräftige Taxonomie der Intelligenz hervorgebracht hat, welche hier anhand ihrer historischen Entwicklung aufgezeigt wird.

Der Vater der Faktorentheorie, Charles Spearman, stellte fest, dass die Noten von Schüler*innen über die Fächer hinweg korrelierten. Tim, der gut in Mathematik ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gut in Deutsch, obwohl beide Fächer verschiedene Kompetenzen abfragen. Die Zusammenhänge innerhalb einer Person in den Leistungen zwischen den Fächern lässt sich gemäss Spearman einem allgemeinen Intelligenzfaktor (g-factor) zurückführen, während die Unterschiede dieser Leistungen durch spezifische Faktoren erklärt werden, die dem g-factor hierarchisch untergeordnet und voneinander unabhängig sind. Das heisst, dass Tim als guter Schüler in allen Fächern gut ist, weil sein g-factor eher hoch ist. Allerdings sind seine sprachlichen Leistungen etwas schlechter als seine mathematischen, weil sein spezifischer Faktor für Sprache schwächer ausgeprägt ist. In seiner Gf-Gc-Theory der Intelligenz gliedert Cattell, ein Schüler Spearmans, den g-factor in die heute gängigen Begriffe der fluiden (Gf) und kristallinen Intelligenz (Gc). Erstere ist unabhängig von der Lernerfahrung und bildet somit die biologische, beziehungsweise genetische Komponente der Intelligenz, indem sie sich auf das Denkvermögen niederschlägt. Die kristalline Intelligenz hingegen bildet die Fähigkeit, erworbenes Wissen anzuwenden (Händel, 2016). Baltes et al. (1995) orientierten sich in der entwicklungspsychologischen Formulierung der Intelligenz an Cattell, indem sie die Mechanik als den Teil der Intelligenz bezeichneten, der den biologisch-evolutionären Teil der Hardware des Gehirns abbildet und dementsprechend vom Gesundheitszustand der Person abhängig ist. Deswegen ist mit fortschreitendem Alter auch ein Leistungsrückgang zu erwarten. Die Pragmatik hingegen entspricht eher der kristallinen Intelligenz. Ihr werden kulturell tradiertes Wissen sowie Strategien der Lebensbewältigung zugeordnet, die über die Lebensspanne hinweg Leistungsstabilität aufzeigt und sogar Zugewinne so lange zulässt, wie es die Mechanik erlaubt. Leonard Horn erweiterte Cattels Gf-Gc-Theorie um weitere 6 Faktoren: visuelle Verarbeitung, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Verarbeitungsgeschwindigkeit, auditorische Verarbeitung, Entscheidungsgeschwindigkeit, quantitatives Wissen und Lese-Schreibe-Fähigkeit (Flanagan & Dixon, 2014).
So weit, so gut. Schon sind einige bedeutende Komponenten der Intelligenz abgedeckt. Allerdings dauerte es bis zum Jahre 1993, bis ein kohärenteres Bild der Struktur der Intelligenz geschaffen wurde. In seiner Abhandlung Human Cognitive Abilities. A survey of factor-analytic studies bot Carroll eine ausgiebige, systematische Analyse der bisherigen psychometrischen Forschung, indem er über 460 Datensätze untersuchte und uns die Three-Stratum-Theory präsentierte (McGrew, 2008). Dabei handelt es sich um ein so umfassendes Werk, dass einer der späteren leitenden Figuren der CHC-Theorie, Kevin McGrew, Carrolls Arbeit mit der Principia Mathematica von Whithead und Russel gleichsetzte (McGrew, 2008). Carroll strukturierte die Intelligenz in drei Schichten (Strata). In der dritten und obersten Schicht ist Spearmans g-factor angesiedelt. Die zweite und mittlere Schicht weist breite Faktoren auf, die im Wesentlichen denjenigen der Gf-Gc-Theory von Cattel und Horn entsprechen und welche eine grosse Vielfalt von Verhaltensweisen in einem bestimmten Bereich steuern oder beeinflussen. In der dritten Schicht sind enge Faktoren, welche spezifisch wirken (vergleichbar mit Spearmans spezifischen Faktoren) und durch die Faktoren zweiter und dritter Stufe beeinflusst werden (Carroll, 1993). Aufgrund der hohen Ähnlichkeit zwischen der Three-Stratum-Theory und der Gf-Gc-Theory entschloss sich McGrew in einem Artikel von 1997, diese beiden Theorien zu synthetisieren, um mit diesem Schirmbegriff der CHC-Theorie der Wissenschaft eine eindeutige Nomenklatur zu liefern (McGrew, 2008) und anhand derer sich kognitive Fähigkeitstests auf einheitliche Weise klassifizieren lassen können (Flanagan & Dixon, 2014). Mittlerweile enthält die CHC-Theorie (Cattel-Horn-Carroll-Theorie) 16 breite Kategorien sowie 80 enge Kategorien und folgt der hierarchischen Struktur Carrolls.
An dieser Stelle liesse sich anmerken, dass diese Faktorenanalyse bis zu einem Punkt exerziert wurde, wo das Modell erheblich an Verständlichkeit einbüsst. Allerdings ist die Psychologie ihren empirischen Ansprüchen insofern treu geblieben, als dass sie mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln versucht (hat), die Realität in ihrer Komplexität so adäquat wie möglich abzubilden. Ob diese Komplexität schliesslich gerechtfertigt ist, unterliegt weiterer Forschung, wie die Autor*innen dieser Theorie selbst betonen. Sie merken an, dass es sich um ein dynamisches Modell der Intelligenz handelt, welches weiterhin reorganisiert wird (Flanagan & Dixon, 2014). Ob sich Enzensberger mit dem Schaffen Carrolls vertraut gemacht hat, sei hier infrage gestellt. Zu Goulds Vorwürfen an die Faktorenanalyse soll an dieser Stelle schliesslich kurz mit den Worten der Vertreter*innen der Gf-Gc-theory entgegnet werden: «[T]he extended theory of fluid and crystallized (Gf and Gc) cognitive abilities is wrong, of course, even though it may be the best account we currently have of the organization and development of abilities thought to be indicative of human intelligence. All scientific theory is wrong. It is the job of science to improve theory» (Horn & Blankson, 2005 zitiert nach McGrew, 2008).

Die Kristallkugel der Psycholog*innen
Um etwas Klarheit über die Bedeutung und Relevanz des IQs zu schaffen, wird an dieser Stelle auf die Arbeit Elsbeth Sterns eingegangen. Die renommierte Lehr- und Lernforscherin ist immer wieder zu Gast bei Podiumsdiskussionen, Interviews, Podcasts und informiert die Leser*innen über den aktuellen Stand der Forschung in der NZZ, dem Tagesanzeiger oder dem Spiegel. Einer kontroversen Aussage Sterns zufolge, gehören 30 Prozent der Gymnasialschüler*innen (vorsichtig geschätzt) nicht ans Gymnasium (Stern & Hofer, 2014). Ihre Argumentation basiert auf der Tatsache, dass die Kantone im Durchschnitt 20 Prozent eines Jahrgangs auf ein Hochschulstudium vorbereiten. Diese Schüler*innen sollten möglichst die oberen 20 Prozent der Normalverteilung abbilden, d.h. ihr IQ müsste zwischen 113 und theoretisch unendlich betragen (Stern & Hofer, 2014). In der Tat fallen aber 30 Prozent dieser Schüler*innen unter die Grenze von 113. Die Notwendigkeit, dass am Gymnasium die Klügsten ausgebildet werden, rechtfertigt sie dadurch, dass nur Personen für anspruchsvolle Berufe vorbereitet werden sollten, die auch das nötige intellektuelle Potential dafür mit sich bringen. Auch würde das Leistungsniveau am Gymnasium und in der Hochschule darunter leiden, wenn viele der Student*innen nicht optimal an dieses Umfeld angepasst sind. Dementsprechend stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch ich als Psychologiestudent eigentlich nicht das mentale Rüstzeug besitze, um über ein solch «hochtrabendes» Thema zu schreiben.
IQ und Normalverteilung
Der IQ folgt einer Normalverteilung in der Population. Das heisst, der arithmetische Mittelwert, der Median (der die Verteilung in zwei gleich grosse Hälften teilt) und der Modus (Höhepunkt) sind identisch und liegen bei 100. Der IQ ist streng genommen kein Quotient, sondern gibt die relative Position einer Person in der Normalverteilung wieder. Demnach ist eine Person mit einem IQ von 100 «klüger» als 50 Prozent der Population.
Diese Stellungnahme mag zunächst reisserisch klingen. Bei der ETH-Professorin handelt es sich allerdings um eine Frau, aus welcher durch und durch die Ratio spricht und die dem Bild einer logisch denkenden Intelligenzforscherin vollumfänglich gerecht wird. Ob ihre Schlussfolgerungen plausibel sind, kann hier nicht beantwortet werden, vielmehr gilt es aufzuzeigen, wie sie zu einer solchen Meinung kommen könnte. Das wird anhand der Evidenz, die in Stern und Neubauers bereits erwähnten Werk Intelligenz: Kein Mythos, sondern Realität (2016) ersichtlich, welche sie zur Verteidigung des IQs einsetzen. Darunter erklären sie, dass dank einer Reihe von Metaanalysen mit Zuversicht behauptet werden kann, dass die Intelligenz eine grosse Rolle für den Erfolg in der Schule, Ausbildung und Beruf spielt (u. a. Süss, 2001; Kuncel, Hezlett, & Ones, 2004; Kuncel & Hezlett, 2007; Kramer, J., 2009; Salgado & Anderson, 2003; Schmidt & Hunter, 2004) sowie zu einem gesunden und glücklichen Leben beiträgt (Deary, 2009; Gottfredson, 1997). Weiter führen sie an, dass «etwa Fleiss, Motivation, Ausdauer und Disziplin, das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit sowie Sozialkompetenz» einen Einfluss auf schulischen und beruflichen Erfolg haben. Diese Faktoren kommen allerdings erst in Stichproben, die bezüglich der Intelligenz homogen sind, zum Tragen (Stern & Neubauer, 2016). Auch präsentieren Stern und Neubauer (2016) die Metaanalyse von Schmidt und Hunter (1998), in der Intelligenztests zu r = 0.5 mit Berufserfolg korrelierten, hingegen das Interesse am Beruf nur zu r = 0.1 mit dem Berufserfolg zusammenhing. Die Vorhersage des Berufserfolgs lässt sich anhand der Interessen unter Berücksichtigung der Begabung allerdings nicht bedeutsam verbessern, so Stern und Neubauer. Auch zeigen Schmidt und Hunter (2004), dass die Intelligenz entgegen landläufiger Behauptung mit zunehmender Berufserfahrung wichtiger wird, während der Einfluss der Erfahrung auf die Leistung abnimmt. Ausserdem sind IQ-Werte auch in den oberen Bereichen sehr aussagekräftig, wie eine Untersuchung von David Lubinski und Camilla Benbow (2006) zeigte. Nämlich ist das obere Viertel der ein Prozent Klügsten der Population (ab einem IQ von 135) wesentlich erfolgreicher als das untere. Denn wie aus der Langzeitstudie ersichtlich wurde, hatten Personen mit IQs von 135 weniger Publikationen veröffentlicht und weniger Patente angemeldet als diejenigen mit IQs von 145 und höher.
Natürlich sind nicht alle Schüler*innen mit einem hohen IQ die Klassenbesten. Und genau darin, dass es nicht alle Schüler*innen mit intellektuellem Potential weit schaffen, sieht Stern ein Versäumnis des Schulsystems, die Intelligenzressourcen optimal zu nutzen (Stern & Neubauer, 2016). Aus dieser Tatsache wird der Einfluss des sozioökonomischen Status auf die Schullaufbahn ersichtlich: «Teilt man die soziale Herkunft grob in drei Klassen und vergleicht die untere und obere Klasse, so gilt: Ein Kind mit einem IQ unter 100 aus der oberen sozialen Klasse erhält mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent eine Gymnasialempfehlung. Mit gleicher Wahrscheinlichkeit wird einem Kind mit einem IQ über 115 aus der unteren sozialen Schicht das Gymnasium empfohlen» (Stern & Hofer, 2014). Damit setzt sie an eben dem Punkt an, wo der Erfinder des Intelligenztests, Alfred Binet, aufgehört hat. Ihm galt es nämlich anhand eines objektiven Tests Kinder, die für eine Sonderschule infrage kamen, zu identifizieren und sie entsprechend zu fördern und zu unterstützen. Stern hingegen fokussiert auf das andere Ende der Normalverteilung, indem sie bei einem beträchtlichen Teil der Schüler*innen eine Diskrepanz zwischen Lernpotenzial und Schullaufbahn feststellt. In diesem Sinne wird der Intelligenztest im Dienste und zur Aufklärung der Gesellschaft eingesetzt. Der IQ-Wert wird demnach nicht als Stempel, sondern als Indikator für eine wichtige Eigenschaft unserer Psyche erachtet, die weitreichende Implikationen auf Verhalten und Lebensweg von Personen mit sich trägt. Demenentsprechend lässt sich die Intelligenz, auch wenn es schmerzen mag, nicht ohne Weiteres aus dem gesellschaftlichen Diskurs streichen.