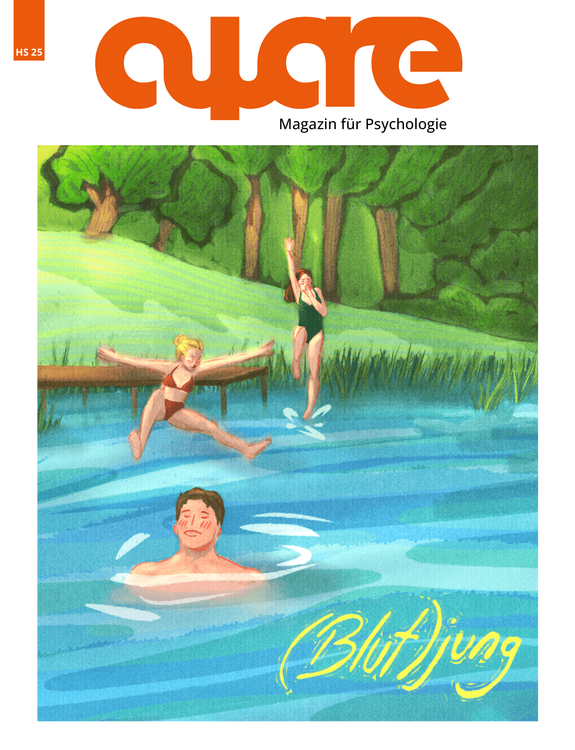Betrachten wir unser Leben als Geschichte mit rotem Faden, Sinn und Kohärenz, scheint der Tod eine Bedrohung zu sein. Das Ende, das wir lieber nicht wahrhaben wollen. Vielleicht könnte unsere Sterblichkeit aber auch ein Weckruf sein – eine Aufforderung, mehr zu leben.
M an sagt: Die einzige Gewissheit im Leben ist der Tod. Trotz dieser Unausweichlichkeit geben wir unermüdlich unser Bestes, den Tod aus unserem Bewusstsein zu verdrängen. Der Tod ist tabu. Während das Sterben früher noch in den gesellschaftlichen Alltag eingebettet war, wird es mittlerweile in Krankenhäuser oder spezialisierte Institutionen verlegt und von der Öffentlichkeit abgeschnitten. Der Tod passiert heimlich, leise, unsichtbar. Und weil wir ihn trotzdem nicht vollständig eliminieren können, wollen wir ihn wenigstens so weit wie möglich in die Zukunft verschieben: Durch die gesellschaftliche Idealisierung von ewiger Jugend, das epidemische Streben nach Gesundheit und Fitness und die rasanten Fortschritte in der medizinischen Technik haben wir dem Tod den Kampf angesagt (Wellman, 2020).
Der Tod in Philosophie, Religion und Kultur
Angesichts der Tatsache, dass die Philosophie sich bereits zu Zeiten des antiken Griechenlands mit dem Tod beschäftigte und bekannte Philosophen wie Heidegger oder Nietzsche das Thema immer wieder aufgegriffen haben, ist es eigentlich verwunderlich, dass er in der westlichen Welt mittlerweile fast vollständig von der geistigen Bildfläche verschwunden ist.
In anderen Kulturen hat der Tod aber auch noch in der heutigen Zeit einen hohen Stellenwert. Im Buddhismus gibt es für das kontemplative Nachdenken über den Tod und die Vergänglichkeit des Lebens sogar einen eigenen Begriff: Maranasati. Dazu gehört zum Beispiel, sich in der Meditation zu vergegenwärtigen, dass niemand – auch man selbst nicht – dem Altern, Krankwerden und Sterben entkommen kann. In Bhutan, welches als das glücklichste Land der Welt bekannt ist, praktizieren die Menschen die Erinnerung an den eigenen Tod sogar fünfmal am Tag (Manser, 2020).
Der Tod in der Psychologie
Auch die psychologische Forschung lässt grösstenteils ihre Finger vom Tod. Eine Ausnahme ist die Terror-Management-Theorie – kurz TMT (Greenberg, Pyszczynski, & Solomon, 1986). Sie ist eine der bekanntesten und einflussreichsten sozialpsychologischen Theorien und basiert auf der Annahme, dass das Todesbewusstsein – eine unangenehme Nebenwirkung der hoch ausdifferenzierten kognitiven Fähigkeiten des Menschen – Angst und Schrecken auslöst. Der Mensch rettet sich in die Kreation der Kultur: ein aus sozialen Konstrukten und kulturellen Weltanschauungen gewobenes Netz, das ein Gefühl von Ordnung, Stabilität und Sinnhaftigkeit vermittelt. Gedanken an den Tod stellen eine Bedrohung dieser Ordnung dar. Das macht Angst – daher: Terror. Der Mensch im Gegenzug seine Abwehrstrategien: einerseits verdrängt er Gedanken an den Tod so gut es geht, andererseits verteidigt er vehement sein kulturell erbautes Weltbild und strebt danach, in diesem System eine Spur zu hinterlassen, die den eigenen Tod überlebt. Die sogenannte symbolische Unsterblichkeit kann auf unterschiedliche Arten realisiert werden: Zum Beispiel biologisch, wenn wir uns fortpflanzen; religiös oder spirituell, wenn wir daran glauben, dass unsere Seele einen neuen Körper bezieht; oder durch Leistung und Erfolge, wenn unser Name weiterlebt (Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 1991).
«In gaining awareness of death, we sharpen and intensify our awareness of life.»
Die theoretischen Annahmen der TMT wurden in zahlreichen Studien belegt und die Theorie gilt als weitgehend gesichert (Dar-Nimrod, 2022). Gleichzeitig existiert ein kleinerer, weniger bekannter Forschungsstrang, der gegenteilige Effekte beschreibt. Studien mit Personen, die aufgrund von Unfällen oder medizinischen Eingriffen nur knapp dem Tod entkommen sind oder die Diagnose einer terminalen Krankheit erhalten haben, zeigen, dass für diese Personen die Konfrontation mit ihrer eigenen Sterblichkeit ein Weckruf ist, der zu radikalen Veränderungen in ihrem Leben führt: Sie schätzen das Leben mehr wert und sind dankbarer, sie erkennen plötzlich, was ihnen wirklich wichtig ist und finden Zugang zu ihren persönlichen Werten. Sie leben authentischer und erfüllter, verfolgen intrinsisch motivierte Ziele und lösen sich von konventionellen, kulturell geprägten Werten wie Erfolg, Besitz oder Status (Bauer, 1985; Martin, Campbell, & Henry, 2004; Martin & Kleiber, 2005). Der Tod nicht als der Feind der Sinnhaftigkeit, sondern als deren Katalysator.
Die Theorie der Dual-Existential Systems von Cozzolino et al. (2006) versucht, die scheinbar widersprüchlichen Befunde zu vereinen und postuliert, dass jeweils zwei unterschiedliche Systeme bei der Verarbeitung von todesbezogener Information involviert sind. Wenn wir in abstrakter, kategorischer Weise mit dem Tod konfrontiert werden, reagieren wir durch Abwehr. Setzen wir uns allerdings vertieft und auf einer persönlichen Ebene mit der eigenen Sterblichkeit auseinander, werden wir daran erinnert, dass wir nur dieses eine Leben haben – und dass wir das Beste daraus machen sollten.

Den Tod in das Leben einladen
Folgen wir der Logik der Dual-Existential Systems, haben wir die Wahl zwischen zwei Alternativen: Wir können den Tod verdrängen, bekämpfen, ihn auf Abstand halten. Das ist vermutlich die kurzfristig angenehmere Alternative, weil wir uns dann nicht mit unseren Ängsten auseinandersetzen müssen. Aber diese Strategie hat ihren Preis: wir verpassen etwas. Soll der Tod als Weckruf dienen, kommen wir um die zweite Alternative nicht herum: wir müssen uns mit unserer Sterblichkeit auseinandersetzen.
Ein Hindernis, das uns auf diesem Weg begegnen wird, ist die Angst. Da ist einerseits die Angst vor dem Sterben und dem Tod. Niemand weiss wirklich, was beim Sterben und nach dem Tod passiert. Das Ungewisse ist unheimlich. Andererseits ist es vielleicht gar nicht so sehr das Sterben an sich, welches wir fürchten. Vielleicht fürchten wir viel eher, nicht richtig gelebt zu haben. Und der Tod führt uns genau das vor Augen.
«Our fear of death is, in large part, a fear of not living before we die.»
Bronnie Ware, die jahrelang in der Palliativpflege tätig war, beschreibt in ihrem Buch die 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen: 1. «Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten», 2. «Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet», 3. «Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen», 4. «Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten», und 5. «Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt». (Bronnie Ware, 2013)

Die Patient*innen von Ware hatten oft keine Zeit mehr, ihre Erkenntnisse umzusetzen. Aber wir können davon lernen. Egal, wie viel Zeit uns noch bleibt – es liegt in unserer Hand, wie wir diese Zeit gestalten. Dafür muss der Tod nicht unmittelbar bevorstehen. Wir müssen es nur wagen, ihn aus seinem mentalen Exil zu befreien. Fakt ist: irgendwann kommt der Moment, in dem unser Leben zu Ende geht. Selbst wenn wir das Glück haben und es über die Ziellinie der durchschnittlichen Lebenserwartung schaffen, ist unser Leben im Vergleich zum Grossen und Ganzen ein Wimpernschlag. Die Erde existiert seit geschätzt 4,5 Milliarden Jahren. Auf einem Zeitstrahl nimmt die Entwicklung des Menschen einen winzigen Abschnitt am Ende ein und um die Dauer eines einzelnen Menschenlebens einzuzeichnen, wäre jeder Strich zu dick. Wir verschwinden so schnell, wie wir gekommen sind. Diese Unbedeutsamkeit ist vielleicht enttäuschend, aber gleichzeitig enorm befreiend. So betrachtet ist es doch ziemlich egal, wie stolz die Summe auf meinem Konto, wie steil meine Karriere, wie gross meine Nase, wie flach mein Bauch ist. Das sind bloss gross-gezoomte Details. Wir haben das Geschenk, auf diesem Erdball für eine Weile Gast sein zu dürfen. Was also wollen wir damit tun? Wofür wollen wir unsere Zeit und Energie wirklich investieren, wofür nicht? Was wollen wir gesehen, gesagt und getan haben? Was wollen wir am Ende unseres Lebens nicht bereuen?
Ja, der Tod macht Angst. In unserem Denken ist er der Feind des Lebens, das Ende der Sinnhaftigkeit. Aber vielleicht ist das nur die halbe Wahrheit. Vielleicht ist es gerade die Endlichkeit des Lebens, welche es so wertvoll, sinnhaft und in sich kohärent macht, weil sie uns dazu motiviert, dieses eine Leben, welches wir zur Verfügung haben, erfüllt, mutig, authentisch und in Einklang mit unseren ganz persönlichen Werten zu leben – so dass wir am Ende sagen: «Wow! What a ride!» (Thompson, 1997).