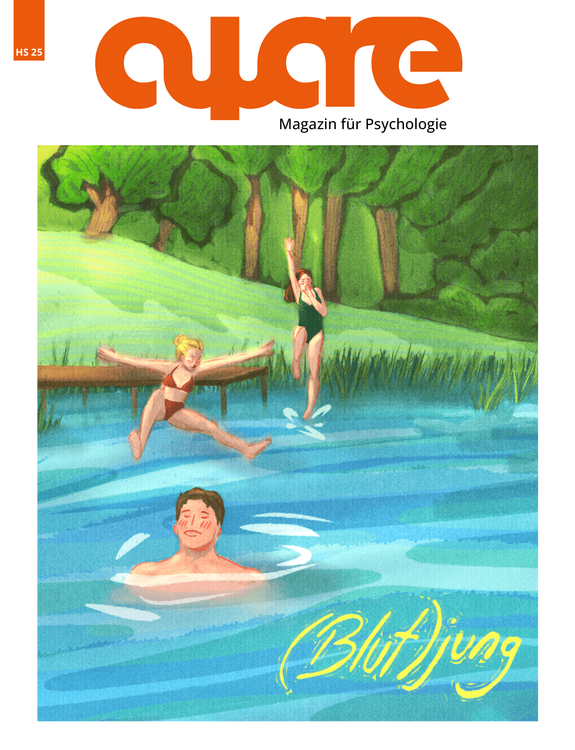Die verhaltensgenetische Forschung versucht uns Einsicht in die Verwobenheit zwischen unseren Genen und dem Umfeld, in welchem wir aufwachsen zu bieten. Dabei mag überraschen, dass die Gene hinsichtlich unserer Umwelteinflüsse ein Wörtchen mitzureden haben.
D as erste Gesetz der Verhaltensgenetik (Turkheimer, 2000) besagt, dass alle menschlichen Eigenschaften vererbbar sind. Von Intelligenz, Persönlichkeit, psychischen Störungen bis hin zur Scheidungswahrscheinlichkeit und Religiosität kann alles auf Unterschiede in der Genvarianz zurückgeführt werden. Das mag nicht überraschen, dennoch besteht die Tendenz Zusammenhänge zwischen Charakteristiken in der Familie und des Kindes allein auf die Erziehungsbedingungen zurückzuführen (Scarr, 1996). Die verhaltensgenetische Forschung zeigt uns, dass solche Zuschreibungen zu einfach ausfallen. In der Tat gibt es Grund zu glauben, dass unsere Gene beeinflussen, was für Umwelten wir uns aussuchen. Bevor wir uns aber an das Konzept Niche-Picking heranwagen, gehen wir auf wichtige Punkte der verhaltensgenetischen Forschung ein.
Die vier verhaltensgenetischen Gesetze
- Alle menschlichen Verhaltensmerkmale sind teilweise vererbbar, d. h., sie weisen ein substanzielles Ausmass an genetischen Einflüssen auf.
- Der Effekt, in der gleichen Familie aufgewachsen zu sein (geteilte Umwelt), ist kleiner als der Effekt von Genen.
- Unterschiede in komplexen menschlichen Merkmalen können nicht allein durch Effekte von Genen und Familie (geteilte Umwelt) erklärt werden, d. h., die nichtgeteilte Umwelt ist wichtig.
- Ein typisches menschliches Verhaltensmerkmal hängt mit einer Vielzahl an genetischen Varianten zusammen, welche jede für sich nur einen winzigen Teil an Unterschieden zwischen Personen aufklären kann. (Rauthmann, 2020)
Nature vs. Nurture ist vorbei
Die Nature-Nurture-Debatte zieht sich durch die gesamte Geschichte der Psychologie und darüber hinaus. Zwar herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass sowohl Umwelt als auch unsere genetischen Anlagen zum Tragen kommen, so zeigen aber Sandra Scarr und Kathleen McCartney (1983) in ihren theoretischen Überlegungen, welche Interaktionsformen diese Kräfte in unserer Entwicklung annehmen können. Darin betonen sie, dass die Entwicklung von Individuen Produkt von Natur und Umwelt sind, die Erfahrungen allerdings durch die Gene angetrieben werden. So unterscheidet sich die Wirkung der Umwelt in Abhängigkeit der Veranlagung. Tatsächlich zählt zu den meistreplizierten Befunden der Verhaltensgenetik, dass dieselben Umweltbedingungen Geschwister unterschiedlicher machen können. Damit ist nicht gemeint, Familienerfahrungen seien unwichtig, aber dass sie auf unterschiedliche Weise auf die Kinder wirken (Plomin et al., 2016).
Die Gen-Umwelt-Korrelation, mit welcher Plomin (1977) den Zusammenhang von Genen und Umwelt beschreibt, liegt Scarrs und McCartneys (1983) Arbeit zugrunde. Die Gen-Umwelt-Korrelation beschreibt also, welche Anlagen in welchen Umwelten häufiger vorkommen. Einfacher lässt es sich direkt an den drei Arten Gen-Umwelt-Korrelationen darstellen: passive, reaktive/evokative und aktive Gen-Umweltkorrelationen.
Passive Gen-Umweltkorrelationen kommen durch Vererbung einer Umwelt, die aufgrund der geteilten Erbanlagen zwischen Eltern und dem Kind mit den Genen des Kindes übereinstimmen. Beispielsweise haben wir zwei Eltern, welche mit sportlichen Genen ausgerüstet sind und entsprechend dem Kind eine Umwelt bieten, in welchem sich diese sportlichen Gene profitabel entfalten können (Plomin et al., 1977). Diese Form der Gen-Umweltkorrelation beleuchtet besonders die Verwobenheit von Umwelt und Genen. Bei Personen, bei denen das Tennistalent «im Blut ist», stehen die Chancen gut, dass sie auch eher die Möglichkeit haben diese zu entfalten. Auch bedeutet es, dass erhobene Umweltvariablen, wie beispielsweise der Erziehungsstil der Eltern, nicht unabhängig von den Genen der Eltern und somit auch nicht von denen des Kindes sein können (Plomin et al., 2016).

Erblichkeit ist nicht in Stein gemeisselt
Auch zeigt uns das Konzept der evokativen Gen-Umweltkorrelation, dass ein geteiltes Umfeld nicht zwingend die gleiche Wirkung auf zwei Individuen hat. Hier wird die Wirkung der Genausstattung auf das Umfeld beleuchtet (Plomin et al., 1977). Angenommen zweieiige Zwillinge befinden sich in derselben Klasse. Da sie etwa 50 Prozent der Gene und rund 100 Prozent der Umwelt teilen, sind ihre kognitiven Fähigkeiten zwar höher korreliert als mit einer zufälligen Person aus ihrer Klasse, dennoch lässt sich feststellen, dass Eva etwas klüger ist als Max. Dies kann unterschiedliches Verhalten der Mathelehrperson im Umgang mit den Zwillingen zufolge haben. Das wiederum kann die Unterschiede zwischen Evas und Max Matheleistungen in Zukunft verstärken. In der Tat kann ein solcher Schneeballeffekt ein Grund sein, wieso mit zunehmendem Alter die Erblichkeit von kognitiven Fähigkeiten zunimmt (Tucker-Drob et al., 2013). Das mag etwas kontraintuitiv klingen, da man annehmen würde, dass mit dem Alter die Erfahrung zunimmt, jedoch nicht die Wirkung der genetischen Ausstattung. Tatsächlich werden aber zweieiige Zwillinge in der Intelligenz mit zunehmendem Alter immer unähnlicher als eineiige Zwillinge, deren Korrelationen relativ stabil bleiben (McGue, 1993). Tucker-Drob und Kolleg*innen führen aus, dass Kinder sich Umwelten aussuchen, die zu ihren Genen passen, welche schliesslich die aktive Gen-Umweltkorrelation darstellt, und diese wiederum Erfahrungen hervorrufen (evokative Gen-Umweltkorrelation), welche die kognitive Entwicklung stimulieren. Ein Beispiel, das sowohl aktive als auch evokative Gen-Umweltkorrelationen abdeckt: Eva mag Mathe und wählt deshalb Mathe-Zusatzkurse in ihrer Schule. Dort trifft sie andere Schüler*innen, die Mathe auch mögen. Es entwickeln sich Freundschaften zwischen Eva und einigen Kursteilnehmenden, was sie motiviert, sich noch mehr mit Mathe zu beschäftigen. Später entscheidet sie sich, ein MINT-Fach zu studieren. Das Studium fördert wiederum ihre mathematischen Fähigkeiten. So kann sich Evas Talent für Mathematik voll entwickeln.
Um nicht den Eindruck zu erwecken, dass aufgrund des Fokus auf die Gene die Umwelt weniger wichtig sei, muss angefügt werden, dass die Erblichkeitsrate kognitiver Fähigkeiten vom sozioökonomischen Status abhängt. Ein tiefer sozioökonomischer Status der Eltern scheint die genetischen Unterschiede zu unterdrücken (Tucker-Drob et al., 2013). Dies konnte allerdings eher in den Vereinigten Staaten als in nordeuropäischen Ländern festgestellt werden, da dort die Unterschiede zwischen den sozialen Klassen grösser sind. Nach Scarr und McCartney (1983) bestimmen die Gene die Wirkung der Umwelt, allerdings sind erstere vom Vorhandensein der Umwelt abhängig.

Gleich und gleich gesellt sich gern
Eine besondere Aufgabe im Jugendalter ist die Herausbildung einer Identität, wofür die Sozialisierung eine grosse Rolle spielt. Es ist nicht überraschend, dass Personen in Persönlichkeitsmassen mit Mitgliedern ihrer Gruppe – wie der Freundesgruppe, des Arbeitsumfelds oder Mitstudierenden – Gemeinsamkeiten zeigen. Was unter Psycholog*innen jedoch diskutiert wird, ist die Frage, ob Personen sich aufgrund ihrer Anlagen ein solches Umfeld ausgewählt haben, oder ob sie durch Sozialisierungsprozesse ähnlicher zu ihrer Gruppe wurden. Letztere Position vertritt Judith Rich Harris in ihrer Gruppensozialisierungstheorie (1995). Darin greift sie auf eine bekannte Erkenntnis aus der Verhaltensgenetik zurück, welches zu Anfang beschrieben wurde: Das familiäre Umfeld macht Geschwister unterschiedlicher (Plomin et al., 2016). So können bei den meisten Eigenschaften die Ähnlichkeit zwischen Geschwister auf die geteilten Gene zurückgeführt werden. Die Umwelt hat zwar einen bedeutenden Einfluss auf die Herausbildung von Persönlichkeitseigenschaften, allerdings stellte sich heraus, dass es sich um mehrheitlich nicht-geteilte Umweltanteile handelt (Plomin et al., 2016). Hier ist Achtung geboten: nicht-geteilt bedeutet nicht, dass zwei Geschwister nicht dieselbe Erfahrung gemacht haben. Dieser Koeffizient ergibt sich aus Umwelteinflüssen, die zwei Geschwister unterschiedlicher machen. Man geht hier davon aus, dass sich das familiäre Umfeld abhängig von der Veranlagung des Kindes auswirkt. Diesen Standpunkt vertritt auch Harris, sie trifft allerdings zusätzlich die Annahme, dass die Peergruppe des Kindes eine primäre Rolle in der Herausbildung von Persönlichkeitsunterschieden spielt. So formen Gruppenprozesse die Persönlichkeit und sind auch dafür verantwortlich, dass wir unserer Peergruppe ähneln.
«The refusal to acknowledge human nature is like the Victorians’ embarrassment about sex, only worse: it distorts our science and scholarship, our public discourse, and our day-to-day lives.»
Die Gegenseite geht eher von aktiver Gen-Umweltkorrelation aus und behauptet die Übereinstimmung der Persönlichkeitseigenschaften zwischen Peergruppe und Person führe überhaupt dazu, dass sich Personen anfreunden (Teneyck & Barnes, 2015). Unter Peergruppe ist die soziale Gruppe Gleichaltriger zu verstehen, mit denen sich das Kind abgibt. So gibt es einige Befunde, dass sich Jugendliche tatsächlich in Umwelten selektieren, die ihren Anlagen entsprechen. Verhaltensgenetiker*innen sprechen hier über Niche-Picking, auch aktive Gen-Umweltkorrelation genannt, was im vorherigen Teil kurz angeschnitten wurde. Die Nische hat sich die Psychologie aus der Biologie abgeschaut. Was in der Nachbardisziplin unter Nischen-Konstruktion verstanden wird – die Auswahl des Habitats, der Paarungspartner, der Ressourcen sowie das Bauen von Nestern, Löchern, Wegen, Dämmen (Laland, 2000) – trifft sicherlich auch auf den Menschen zu. Allerdings belegen alle Menschen nicht nur räumlich, sondern auch sozial eine Nische. Niche-Picking stellt damit die Auswahl oder Konstruktion einer sozialen Nische dar, die auf den Anlagen einer Person basiert.
Niche-Picking: Wie Gene unsere Umwelt mitkonstruieren
Zunächst muss wiederholt werden, dass auch «Umweltvariablen» nicht frei von Geneffekten sind (Plomin et al., 2016). In der Tat lassen sich bei Umweltvariable wie Erziehungsstil oder Lebensereignisse, zum Teil auf Gene zuschreiben (Button, 2008). Der Erziehungsstil selbst kann genetische Anlagen der Eltern und dadurch auch die des Kindes reflektieren, wie dies bereits bei der passiven Gen-Umweltkorrelation angeführt wurde. Auch gibt es gute Gründe anzunehmen, dass aktive Gen-Umweltkorrelationen nicht unbeteiligt an der Mitgestaltung unserer Umwelt sind. Nicholas A. Chrisitakis und James H. Fowler (2015) analysierten mithilfe einer Datenbank die Gene von über 1.000 Freundespaaren und konnten feststellen, dass die Gene von Freunden in etwa so stark wie die von Cousins und Cousinen vierten Grades übereinstimmen. Auch konnten Cleveland und Kolleg*innen (2005) feststellen, dass die Beziehung unter rauchenden und trinkenden Jugendlichen zu einem überwiegenden Anteil auf genetische Einflüsse zurückgeführt werden können. So können auch Lebensereignisse, die sich prägend auf uns auswirken, die Folge einer solchen Selbst-Selektion sein.

Genau hier sehen Iervolino et al. (2002) eine Schwachstelle in der Gruppensozialisierungstheorie von Harris. Sie argumentieren nämlich, dass Harris zwar passive Gen-Umweltkorrelation mitberechnet, wenn es um Eltern-Kind-Korrelationen geht, allerdings völlig die genetischen Anteile von Umweltbedingungen ausserhalb der Familie vernachlässigt. Genau dies haben Iervolino und Kolleg*innen mit ihrer Hypothese überprüft, dass genetische Faktoren die Gruppenauswahl mitbestimmen. In ihrer Studie untersuchten sie die Peer-Gruppenpräferenzen hinsichtlich College-Orientierung, Delinquenz und Beliebtheit in unterschiedliche Konstellationen von Geschwistern (darunter Stiefgeschwister, Adoptivgeschwister, Zwillinge, getrenntlebende Geschwister). Konsistente Ergebnisse konnten sie allerdings nur bei der College-Orientierung (damit ist gemeint, ob die Jugendlichen eine Freundesgruppe bevorzugen, die gerne an ein College möchte) finden. Die Autor*innen führen dieses Ergebnis darauf zurück, dass die College-Orientierung den erheblichen genetischen Anteil hinter Intelligenz widerspiegelt. Insofern mussten sich Iervolino und Kolleg*innen eingestehen, dass an Harris Hypothese etwas dran ist. Denn aus diesen Ergebnissen lässt sich schliessen, dass Gemeinsamkeiten zwischen Mitgliedern einer Peergruppe demnach nicht allein Resultat von Niche-Picking sind, sondern Peergruppen einen potenziell wichtigen nicht-geteilten Umweltfaktor in der jugendlichen Entwicklung darstellen. Also auch wenn es gute Gründe gibt zu glauben, dass die Umweltgestaltung nicht unbeeinflusst von unseren Anlagen ist, beruhigt es dennoch, dass nicht alle Aspekte unserer Erfahrung in eine Reihe von Basenpaaren schicksalhaft vorprogrammiert wurden.