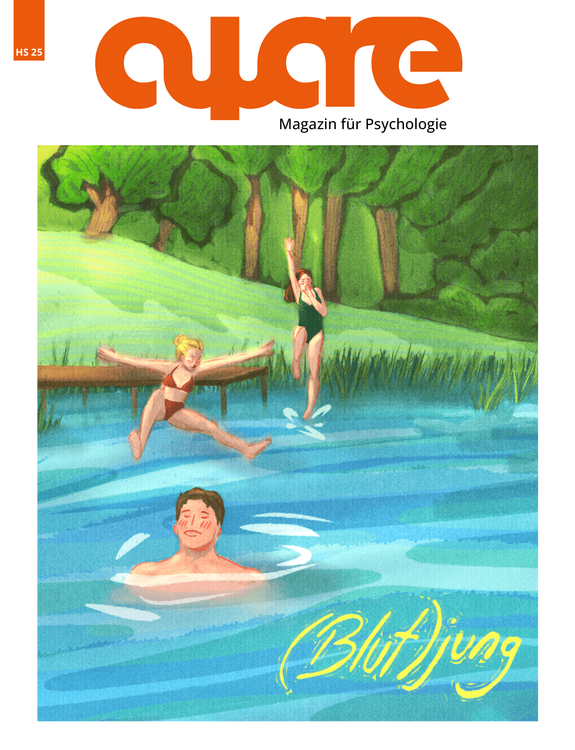Durch das Infragestellen des binären Geschlechtersystems ändert sich der Fokus der geschlechterspezifischen Gehirnforschung – die Frage, ob zwei biologisch distinkte Gehirne die Norm bilden, bleibt.
M it dem wissenschaftlichen Fortschritt und den neuen technologischen Inventionen, welche diesen überhaupt ermöglichen, tauchen zahlreiche neue Fragen auf, und manche alte persistieren. In den Neurowissenschaften widmet sich ein grosses, beharrliches Interesse den Unterschieden zwischen dem biologisch männlichen und weiblichen Gehirn, welches bereits vor mehr als 200 Jahren das vorsichtige Abwägen, Messen und Sezieren diverser Gehirne zur Folge hatte (Rippon, 2020). Aus diesem Interesse resultierten über die Jahre Berichte über kleine, signifikante Unterschiede zwischen den Gehirnen – die Glaubwürdigkeit dieser Resultate wird jedoch durch Inkonsistenz, Publication Bias, tiefe statistische Power sowie andere methodische Mängel in den Studien berechtigt in Frage gestellt (Allen et al., 1991; Giedd et al. 1997; Hausmann, 2017; Elliot, 2019). Die Rede von einem distinkt geschlechtsspezifischen Gehirn basiert also weitgehend auf einem Mythos (Fine, 2011).
Wie sich Mythen untereinander fortpflanzen
Dass der Mythos des geschlechtsspezifischen Gehirns mit anderen verbreiteten Neuromythen, wie der rechts-/links-Asymmetrie und der Korrelation zwischen Gehirngrösse und Intelligenz, in Beziehung steht, verwundert kaum, zumal sich diese Annahmen gegenseitig unterstützen. So handelt es sich beim Left Brain, Right Brain Mythos um den Gedanken, dass sogenannte rechts-spezialisierte Gehirne kreativ und intuitiv sind, während links-spezialisierte Gehirne eine höhere Affinität für Mathematik und Logik aufweisen – ähnlich zu traditionellen Geschlechtsmerkmalen (Corballis, 2014; Marcus, 2017). Dies steht wiederrum in Beziehung zu der Size matters Kontroverse, wonach die grössere Breite eines kleinen Teils des Corpus Callosums – vermittelt in einer nicht signifikanten Studie mit einer kleinen Stichprobe – bei Frauen bedeuten soll, dass bei ihnen eine höhere interhemisphärische Kommunikation vorliegt und sich die Hemisphären deswegen bei verschiedenen Aktivitäten in die Quere kommen (Rippon, 2020). Neben einer tieferen Breite dieses Teils des Corpus Callosums verfügen Männer im Durchschnitt auch über ein grösseres Gehirnvolumen, welches laut eines verbreiteten Irrglaubens mit einer höheren Intelligenz korreliert; diese Mythen persistieren, obwohl es gegenwärtig unklar ist, welchen Einfluss die Grösse verschiedener Hirnregionen auf das Verhalten und die Fähigkeiten eines Menschen hat (Burgaleta et al., 2012; Rippon, 2020).
Die Problematik des Mythos und eine Alternativerklärung
«L’esprit n’a point de sexe»: Bereits im 17. Jahrhundert kam Philosophe François Poullain de la Barre basierend auf der Sezierung des weiblichen und männlichen Gehirns zum Schluss, dass sich die Gehirne kaum unterscheiden – ein Befund, welchen state-of-the-art Technologien replizieren (Rippon, 2020). Trotzdem findet das Thema noch heute viele aufmerksame Zuhörer in der Forschung, dies nicht zuletzt aus problematischen Gründen, wie dem Versuch, die Überlegenheit eines Geschlechtes durch die Wissenschaft zu begründen (Rippon, 2020). Die Forschung über Geschlechterunterschiede im Gehirn ist an sich jedoch nicht problematisch, sofern sie mit dem Motiv des Verstehens unterschiedlicher Verhaltensweisen oder Störungsprävalenzen ausgeführt wird – denn dass sich die biologischen Geschlechter in gewissen Verhaltensweisen unterscheiden, ist wahr (Fine, 2011). Diese Unterschiede finden jedoch eher Begründung in sozialen Aspekten wie Stereotypen und kulturellen Annahmen, welche wiederum unser Gehirn durch dessen Plastizität über die ganze Lebensspanne formen (Fine, 2011; Rippon, 2020).