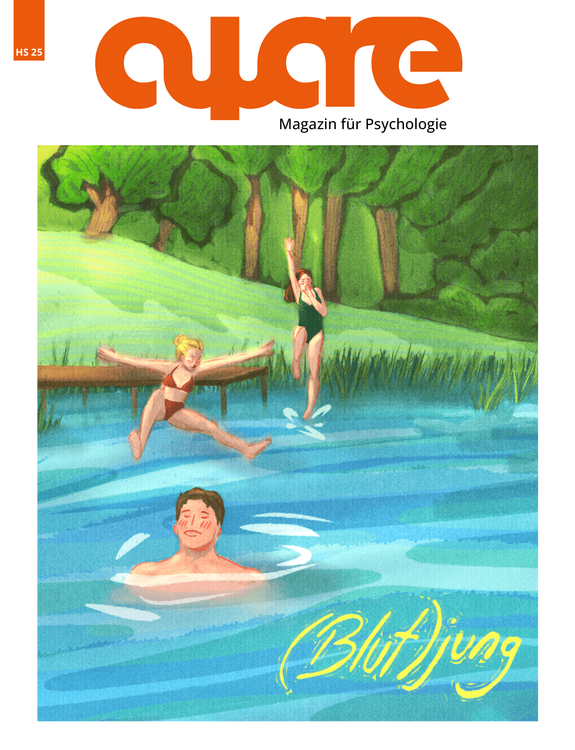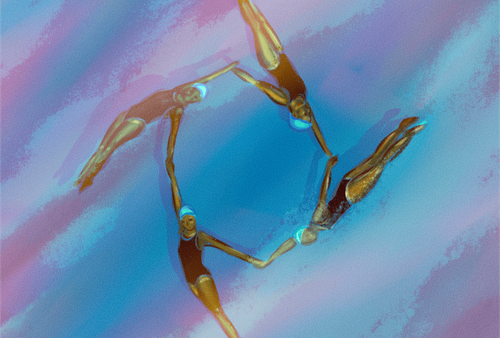Der Besser-als-der-Durchschnitt-Effekt und Erklärungsansätze für das robuste sozialpsychologische Phänomen.
H at der seinen Führerschein im Lotto gewonnen? Grüner wird’s nicht. Du hast das Gaspedal mit gezahlt, also nutz es auch. Klassische Sprüche von Autofahrer*innen, denn natürlich fährt man einfach etwas besser Auto als der Durchschnitt. Eine Einschätzung, die viele zu teilen scheinen. Eine Studie von Svenson (1988) ergab, dass 88 Prozent der amerikanischen College-Studierenden sich selbst als über dem 50. Perzentil liegend einschätzten, was die Fahrsicherheit betrifft. Diese überdurchschnittliche Einschätzung liess sich anscheinend auch nicht durch Autounfälle beeinflussen. In einer früheren Studie von Preston und Harris (1965) wurden 50 Autofahrer*innen, die nach Autounfällen ins Krankenhaus eingeliefert worden waren (von denen 34 die Unfälle laut Polizeiunterlagen verursacht hatten), mit 50 gleichaltrigen Fahrer*innen ohne Unfallgeschichte verglichen. Hier konnte gezeigt werden, dass beide Gruppen ihre Fahrfähigkeiten als überdurchschnittlich gut einschätzten, und dass sich die Unfallgruppe in der Bewertung ihrer Fahrfähigkeiten nicht von den unbeteiligten Fahrer*innen unterschied.
Dieser Effekt wird in der Literatur häufig Besser-als-der-Durchschnitt-Effekt genannt. Der Besser-als-der-Durchschnitt-Effekt beschreibt die robuste Tendenz, sich selbst besser als den Durchschnitt einzuschätzen und ist eine der verlässlichsten Beobachtungen der Sozialpsychologie. Während sich der Besser-als-der-Durchschnitt-Effekt auf Vergleiche zwischen sich selbst und dem Durchschnitt von Peers besonders in Bezug auf Verhaltens- und Merkmalsdimensionen bezieht, beinhaltet zum Beispiel der optimistic bias Vergleiche in Bezug auf Lebensereignisse wie Lottogewinne oder Scheidungen. Beim Besser-als-der-Durchschnitt-Effekt handelt es sich um eine Art des sozialen Vergleichs, bei dem Personen gebeten werden, sich selbst in Bezug auf einen normativen Standard zu bewerten, nämlich eine*n durchschnittlichen Gleichaltrige*n oder den Mittelpunkt einer Verteilung (Alicke & Govorun, 2005).
Die Tendenz, sich als besser als der Durchschnitt einzuschätzen, ist in vielen Bereichen anzutreffen. So enthielt eine Studie in Nebraska eine Frage, in der die Professoren gebeten wurden, ihre Lehrfähigkeiten zu bewerten. Die Ergebnisse zeigten, dass 94% der Lehrkräfte sich selbst als überdurchschnittlich gut in der Lehre einschätzen (Cross, 1977).
Der Effekt wird weniger stark, wenn man einen konkreten Vergleich hat, wodurch man sich also nicht mehr mit dem Durchschnitt, sondern mit einem bestimmten Kollegen, einer bestimmten Kollegin vergleicht. Weiterhin moderierend kann auch das Antwortformat wirken, ich mit dem Durchschnitt oder den Durchschnitt mit mir vergleichen, sowie die Definition der Vergleichsdimensionen oder deren Kontrollierbarkeit. Personen definieren zum Beispiel Lehrfähigkeit auf eine Art, die deren Rang auf eine bestimmte Art maximiert, wie möglich bei den Professor*innen in der Studie von Svenson (1988). Individuelle Differenzierungsfaktoren, besonders Selbstwertgefühl und Depressionen, sind nicht ausser Acht zu lassen, denn sie beeinflussen den Effekt auch (Alicke & Govorun, 2005).
Erklärungen für den Effekt erscheinen häufig plausibel, sind aber flexibel und kaum testbar und können den Effekt deshalb auch schlecht vorhersagen. So legen narrative Erklärungen dem Effekt motivationale oder non-motivationale Faktoren zugrunde, wie beispielsweise selektives Auswählen von Vergleichsinformationen, Fokussierung auf sich selbst und Mehrgewichtung der eigenen Eigenschaften. So oder so dient die Tendenz, entweder strategisch oder unabsichtlich, der Förderung eines positiven Selbstbildes (Alicke & Govorun, 2005).
Man weiss noch immer nicht wirklich, was genau Gründe für den Besser-als-der-Durchschnitt-Effekt sind und wie er im Detail wirkt. In der Forschung konnte häufig gezeigt werden, dass wir uns selbst über eine durchschnittliche Vergleichsnorm stellen und positiver einschätzen als andere. Klar ist aber, wer sich selbst gut findet, ist weniger anfällig für negative Stimmungen und Depressionen (Taylor et al., 2003).